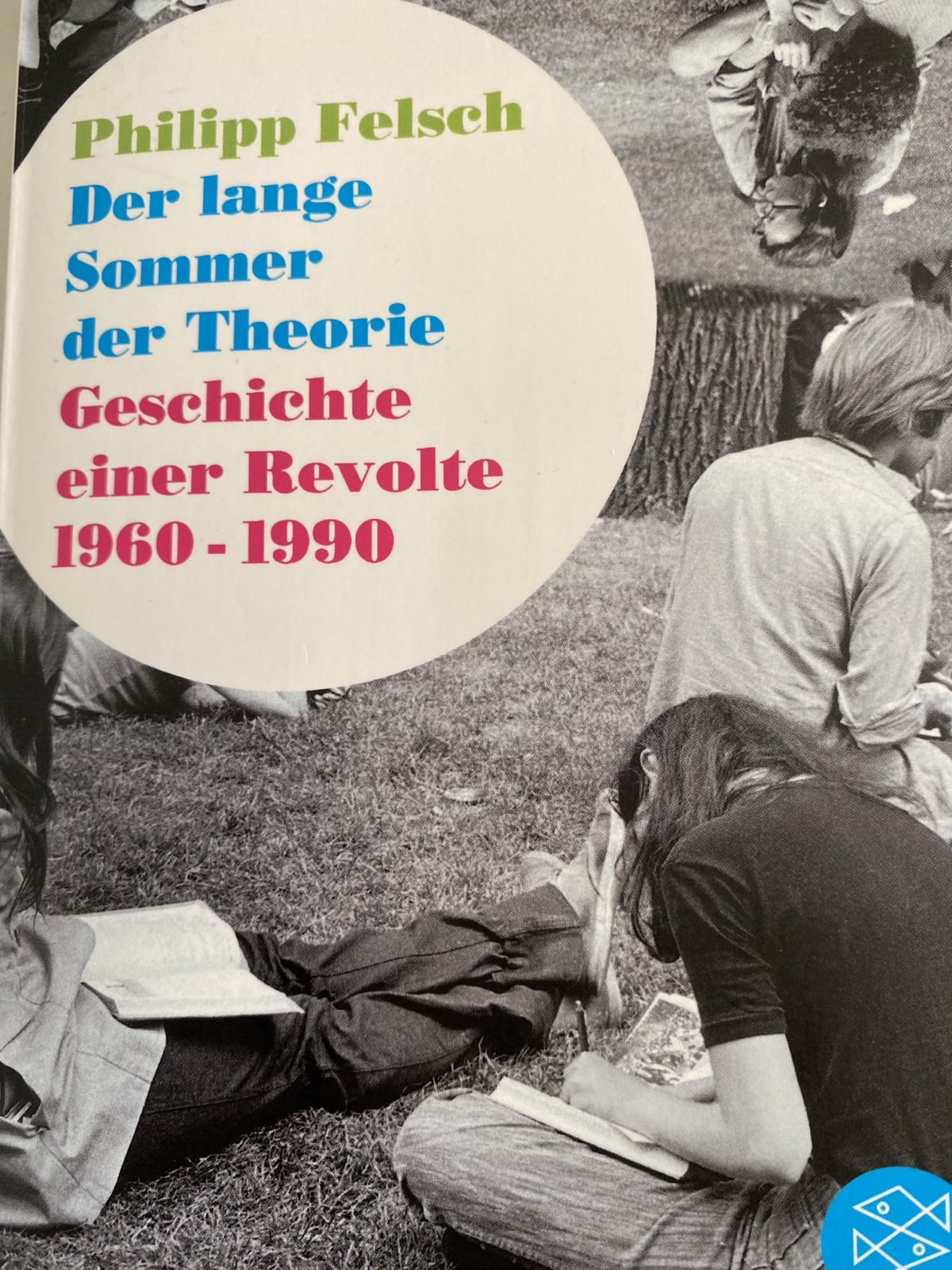Wer, wie der Autor und Blogbetreiber als Angehöriger der ersten Nachkriegs-Generation sich heute den Agenden der aktuellen politischen Jungendorganisationen ausgesetzt sieht, der kommt nicht an der Notwendigkeit vorbei, einen Vergleich vorzunehmen, wie es in den Jahren 1960 – 1990 war. Und welche dedizierten Unterschiede durch den Vergleich feststellbar sind.
Einerseits sind die ökonomischen wie gesellschaftlichen Realitäten der ersten Jahrzehnte nach dem Weltkrieg zu beschreiben und anhand historischer Ereignisse zu kartieren. Dazu gehören Stichwort artig Begriffe wie: ´68er-Generation, Mehr Demokratie wagen durch den Politikwechsel von CDU/CSU zur Sozialliberalen Demokratie unter Brand und Schmidt, RAF-Terror, Friedensbewegung in Zeiten des Kalten Krieges, das Ende der DDR und die Wende. Aber auch der Beginn des Neoliberalismus als Restauration des alten Wirtschaftssystems und Umkehrung der Kommunitarismus-Schwerpunkte durch Zerschlagung der Gewerkschaften.
Die drei Jahrzehnte des sich Freischwimmens von den weiterhin wirksamen Seilschaften und Netzwerke der Faschisten und Nazis in der Finanzwelt, in den Führungsetagen der Konzerne, in den Hochschulen und in den Bildungssystemen, sowie in der Exekutive mit ihrer politischen Bürokratie und der Judikative war Ziel der Studentenbewegung und in den Abiturklassen der sechziger und siebziger Jahre.
Mit seinem Werk „Der lange Sommer der Theorie / Geschichte einer Revolte 1960 – 1990“ beschreibt Philipp Felsch diese Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs auch als eine „ geistige Revolte“ gegen den „Muff von 1000 Jahren, unter den Talaren!“. Ein Zeitraum, in dem die Suche nach einer „Theorie“ für ein grundlegend anderes Lebensmodell eine ganze Generation faszinierte und verband.
Um Kants Fragen und seine Antworten:
- Was kann ich wissen?
- Was soll ich tun?
- Was darf ich hoffen? und
- Was ist der Mensch?
ging es mit der Suche nach neuen Theorien der Nachkriegsgeneration nicht mehr. Es wurde gelesen und debattiert, als sei diese Tätigkeit die neue Erotik im Erlebens- und Erkenntnisraum der studentischen Jugendlichen und des gesellschaftlichen Nachwuchses der `68er.
In der Differenzierung zu den aktuellen Erpressungsversuchen der heutigen Nachwuchsgenerationen á la Junge Union in Sachen Rentenreform – wohl deren einziges Kerngeschäft, in das sich, Macht demonstrierend, verbissen wird, mit dem für neoliberalistisch wichtigen Ziel der Privatisierung der Alterssicherung – war nach Felsch der Zeitraum der dreißig Jahre von 1960 – 1990 eine „Epoche, in der das Denken noch geholfen hat!“, um mit selbstbewusstem Elan den Diskurs voranzutreiben zu neuen soziologischen, philosophischen und kulturellen Erkenntnissen. Zumindest erschien es der damaligen Studentenbewegung als eine intellektuell fruchtbare Periode, noch nicht abschätzend, in welche Abgründe es Teile dieser Generation führen würde in den 1970er Jahren (RAF-Terror). Neue Formen und Methoden der Debatten versprühten ein Aufbruchsgefühl, das sich widerspiegelte in der Politik einer neuen sozialliberalen Regierungskoalition aus SPD und FDP unter dem Bundeskanzler Willy Brandt mit dem Motto „Mehr Demokratie wagen!“
Ergebnis offen zeichnete sich die damalige Jugend durch Hoffnungen, aber auch Irrwege aus, während die eindimensionale Debatte der heutigen politischen Nachwuchsgeneration sich um die Maximierung und unwiderrufliche Festschreibung von Privilegien und Entscheidungsmachterhalt in der Umgebung der neoliberalen Finanzwirtschaft dreht.
Die – mit der neuen sich entwickelnden offenen Gesellschaftsform einhergehenden – Freiheit versprach eine gerechtere, sozialere und solidarischere Gestaltung der Lebensentwürfe, die vor allem den Widerstand der ewig Gestrigen und Machtverlust fürchtenden erzkonservativen Schichten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf den Plan riefen. Unterstützt durch Verlagshäuser und ihre Medienmacht der Printerzeugnisse (Bild, Welt) wie zum Beispiel aus dem Hause Axel Springer und Co.
Während mit diffamierenden Methoden die um Machtverlust fürchtenden alten Eliten Vorurteile wie Jauche verteilten – goutiert von den Menschen, die den alten Methoden des Obrigkeitsdenkens kaum aufgeklärtes und selbst erkennendes Selbstbewusstsein entgegenstellten, sondern stattdessen von „aufhängen an den langen Haaren“ oder „an die Wand stellen und schießen“ lamentierten – begleiteten neue Verlage mit ihren Buch-Programmen die Verbreitung der kritischen Literatur und wissenschaftlicher Gesellschaftstheorien.
Neben dem Suhrkamp-Verlag waren vor allem kleinere Verlage (Verve) beeinflussend beteiligt, wie Felsch in seinem Werk „Der lange Sommer der Theorie“ betont. So gelangten aus den Archiven und Bibliotheken der Universitäten Adornos Werk „Minima Moralia“, ebenso Erich Fromms „Haben und Sein“ und die Schriften der Frankfurter Schule als „Kritische Theorie“ von Max Horkheimer und Theodor W. Adornos „Dialektik der Aufklärung“, sowie Jürgen Habermas „Erkenntnistheorie“ oder Hannah Arendts Werke zur Aufarbeitung der Hitler-Diktatur „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ ; „Wahrheit und Politik“ und „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ als Taschenbuchformate in eine breitere Öffentlichkeit für die interessierten Teile der Gesellschaft.
Auch der Blogbetreiber nutzte die täglichen Fahrten vom Land in die Stadt zum ehrwürdigen humanistischen Gymnasium KKG für das Studium der – neue Sichtweisen ermöglichenden – Taschen-Bücher. Mit „Sit-ins“ und der Forderung nach neuen Formen der Schülermitbestimmung sahen sich das Lehrer-Kollegium und die Schulleitung – unter dem von Schülern „Zeus“ genannten Schulleiter – einem neuen Selbstverständnis der Abiturienten entgegengestellt. Von den Abiturienten wurde eine Energie eingebracht, die das intellektuell Gelernte für den Diskurs praktisch anwendete, und dem die überforderten Lehrpersonen aufgrund ihrer fehlenden Flexibilität nichts entgegen zu setzen hatten. Auch weil keine Bereitschaft bestand, die zwar bequemen, aber völlig überholten Abläufe zu überdenken und Demokratie – als Lehrinhalt beauftragt – nun endlich zu praktizieren. Mit dem ´68er Selbstbewusstsein begann der Abbau des ewig Gestrigen und der damit verbundene Einfluss der alten Netzwerke. Auf das Denken der Menschen nahmen Philosophie, Soziologie und Psychologie Einfluss und ihre Erkenntnisse und Theorien standen in großer Bandbreite zur Verfügung.
Philipp Felsch stellt mit seinem Buch einen roten Faden durch dreißig Jahre Bundesrepublik zur Verfügung. Die Gewohnheiten des Campus als Spielfeld der Professoren, die wie im Bereich der Philosophie „… sich darauf beschränkten, den Sinn des Seins (Heidegger: Das Nichts nichtet…) und die Texte der Klassiker auszulegen, hatte das neue Denken der ´68er nichts zu tun“, wie Felsch formulierte.
„Statt auf ewige Wahrheiten zielte es auf die Kritik der Verhältnisse ab …“ (Felsch).
Die alltäglichen Vorgänge begannen im Bewusstsein ihrer Relevanz für das Leben in der Gesellschaft hinterfragt zu werden. Das bedeutete, dass das Handeln und Denken der bisherigen Elite aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kritisch in Augenschein genommen wurden. Die Demokratie wurde nicht mehr nur von der zuvor genannten Gruppe bestimmt, sondern begann von weiteren Teilen der Gesellschaft praktisch gelebt zu werden.
Wer wie daran beteiligt war und mit welchen Folgen, wird in weiteren Beiträgen und ergänzend aus den Erinnerungen des Blogautors beschrieben werden.