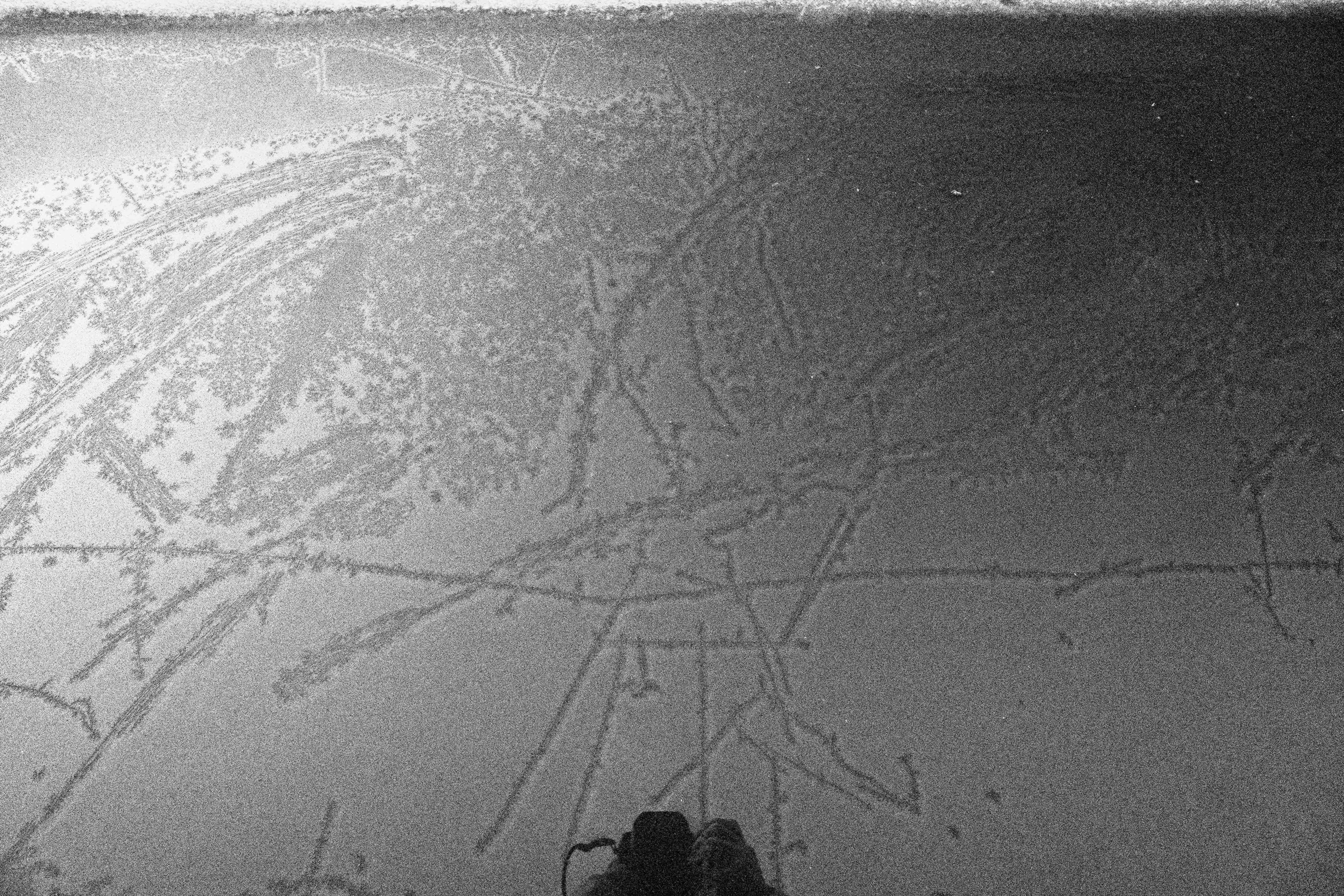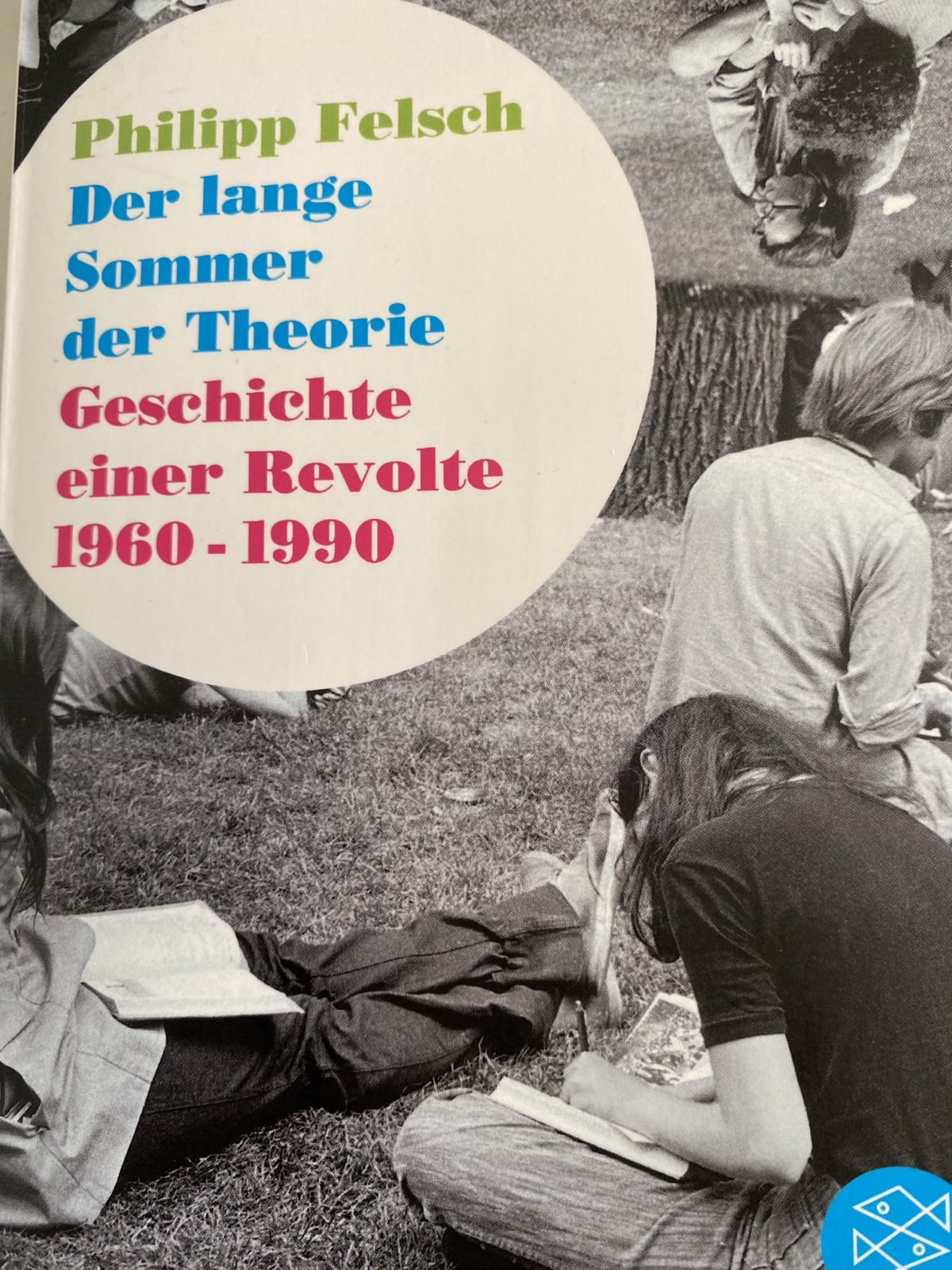Philipp Felsch – Der lange Sommer der Theorie / Geschichte einer Revolte 1960 – 1990 Teil 2
Wie liest und erobert der Interessent Felschs Buch „Der lange Sommer der Theorie“ dessen Inhalte? Einerseits auf bekannte Art und Weise, in dem der vorgegebenen Form gefolgt wird anhand des Inhaltsverzeichnisses – chronologisch und fein der Reihe nach und dem vom Autor Felsch vorgegebenen Aufbau folgend.
Oder – vielleicht unterhaltsamer, individueller und spannender – in dem der Leser der Spur der „aphoristischen Bonmots“ im Text folgend und die wie Ostereier an den passenden Stellen eingefügten literarisch-kreativen Sätze aufspürend.
Beispiel: „Mit dem Godesberger Programm hatte die SPD 1961 die Unvereinbarkeit ihrer politischen Linie mit dem SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) erklärt.“
(Mit der Folge, dass die finanzielle Unterstützung danach ausblieb!) Dieser Bruch mit der Mutterpartei und den nicht selten dominierenden Gewerkschaftsfunktionären aus dem konservativ bis reaktionären Umfeld von IG Bergbau und Energie und IG Bau – nicht selten als „Betonköpfe“ uralter Strategien und Methoden der politischen Arbeit beschrieben.)
Beispiel 2: „Angesichts der Gewerkschaftsfunktionären, die stolz darauf waren, keine Bücher zu lesen und angesichts der neu ausgerichteten Godesberger-SPD, die sich dem Kleinbürgertum an den Hals werfe, müsse der Weg der Neuen Linken in den Weinberg der Texte (der Textanalyse und Theoriebildung) führen.“
Das neue Ziel des finanziell trockengelegten SDS war nach 1961 „analog zur Arbeiterbewegung im Laufe der 1960er bis zu den ´68er Gefilden die Studentenbewegung zu formieren“.
Worauf die Korrekturbemerkung zu diesem Ansatz aus den eigenen Reihen kam mit der Warnung vor dem kulturkritischen Ungefähr der Nonkonformisten im SDS, die „glauben, schon revolutionär zu sein, wenn sie in den Jazzkellern sitzen und die Haare á la Enzensberger tragen.“
Ein Beispiel dafür ist darin zu finden, wie die Debattierlust ausufernd und zerfleddernd in das Chaos der Auslegung der Schriften Karl Marx endete und die Debatten die Energien band, welche Interpretation des Marxismus der richtige Ansatz sei: der unverfälschte Marxismus (Karl Marx und sein Schlussfolgerungen aus dem 19. Jhdt.) oder der revidierte Marxismus und die mäandernden Ansätze von Marxisten-Leninisten, Stalinisten, Maoisten, KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland) zu dem spätere Polit-Karrieristen gehörten wie Ulla Schmidt (SPD – Gesundheitsministerin), Winfried Kretschmann (Grüne – aktueller Ministerpräsident Baden-Württemberg) u.a.
Die Revolutionsfantasien der damaligen KBW-Mitglieder verblassten im Laufe der Jahrzehnte und die Tröpfe des Neoliberalismus versenkte seine „Kinder“ in die Annehmlichkeiten des überbordenden Wohlstandes der Berufspolitiker, wie der Blogautor aus eigenen zeitgleichen Beobachtungen machen konnte. Beim „Marsch durch die Institutionen“ waren die Verführungen zu groß für ihre menschlichen Schwächen. Doch 180°-Schwenkungen im Denken und Handeln sind Anzeichen für einen Verlust des ethisch-moralischen Kompasses! Haben und Sein dieser Politprominenz gingen immer mehr eine pekuniäre Verbindung ein, wie sich an den Aufsichtsratspositionen nach der Politfunktionsverrentung von Ulla Schmidt ablesen lässt.
Philipp Felschs Protagonist Peter Gente, der spätere Merve-Verleger, durchlief verschiedene Metamorphosen: vom Adorno-Exegeten zum Abbild Walter Benjamins – zumindest vom äußeren Erscheinungsbild des Peter Gente in der zweiten Hälfte der 1960er.
„He didn´t write“ zitiert Felsch einen Freund Gentes als Kurzbeschreibung seiner Fähigkeiten. Die lagen wohl eher darin, dass er das Feld der Theorien der offenen Gesellschaft von Neuen Linken, der Antiautoritären Erziehung bis hin zu den Kommunarden Fritz Teufel und Rainer Langhans beackerte und erste kleinere Verlegungen und Herausgaben produzierte. Noch aber flog Gente mit seiner sich schon herauskristallisierenden Beobachtung und Kontakten zu der französischen Philosophenszene (Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Niklas Luhmann oder auch Roland Barthes) unterhalb des öffentlichen Verlagsradars in der Bundesrepublik und Berlin. Erst in den 1970er und dem Jahrzehnt bis Anfang der 1980er Jahre erreichte der Verve-Verlag seine hochakzeptierte Nische neben dem dominierenden Suhrkamp-Verlag und dem Unseld-Verlag, der nicht zuletzt andere Koryphäen der Philosophenszene wie Jürgen Habermas, Hans Blumenberg u.a. vertrat.
Philipp Felsch verweist auf die Rolle des promovierten Soziologen und Philosophen Jacob Taubes im Rahmen der Taschenbuch-Entwicklung und der Buchreihe über die Herausgabe der Arbeiten neuer Autoren, die „das Bewusstsein der Gegenwart (der 60er und 70er Jahre)“ auf den Punkt brachten.
Taubes Einfluss – laut Felsch – verhinderte, dass „die Professorenphilosophie (der Institute) der Philosophieprofessoren“ die Inhalte und literarischen Formen beherrschte.
In dieser Gemengelage um die „neue Formel für die Verschiebung der Lesegewohnheiten“ zu formulieren, welche auch zur Folge hatte, dass der „Relevanzverlust der schönen Literatur“ zu verzeichnen war und stattdessen der „Siegeszug der theoretischen Literatur“ begann, in der „Theorien wie Romane verschlungen werden konnten“, und damit ein neues Marktsegment mit wachsenden Umsätzen entstand, war auch für Peter Gente 1970 der Anlass zur Gründung eines eigenen Verlags – des Merve-Verlag, wie Philipp Felsch betonte.
Version vom 22.11.2025 / 09:55 Uhr (Einfügung Fotos)